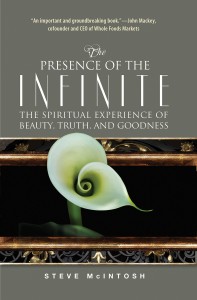 Integrales Gottesbild: postmoderne Non-Dualität und traditionelle Transzendenz zusammendenken
Integrales Gottesbild: postmoderne Non-Dualität und traditionelle Transzendenz zusammendenken
Eine Besprechung des Buches „The Presence of the Infinite“ von Steve McIntosh
Oliver Griebel
Steve McIntoshs neues Buch halte ich in der integralen oder evolutionären Philosophie für wegweisend. Um McIntoshs Denken zu verstehen, ist es vielleicht ganz aufschlussreich, wenn ich gleich zu Anfang schreibe, wie ich „auf ihn gestoßen bin“. Seit meinem Philosophie-Studium Mitte der 90er Jahre war ich auf der Suche nach einem Gottesbild, das unserem modernen Weltbild und Menschenbild wirklich angemessen wäre. Die zwei traditionellen Bilder von Gott überzeugten mich beide nicht: weder das westlich-transzendente Bild von Gott, das man in der Philosophie „theistisch“ nennt – noch das östlich-immanente, so genannte „pantheistische“, das unter dem Namen „Non-Dualität“ auch die meisten aktuellen westlich-spirituellen Strömungen inspiriert. Beide erschienen mir einseitig – und naturwissenschaftlich wie philosophisch zu wenig zu sein. Um 2002 herum hatte ich eine Idee für eine dritte Art Gottesbild, die ich 2009 in Buchform fertig skizziert hatte („Der ganzheitliche Gott – Die Idee einer liebevollen Ordnung der Dinge“). Im Jahr 2012 dann, etwa zur gleichen Zeit, als ich Ken Wilbers integrale Ideen entdeckte, stieß ich auch auf die zwei angelsächsischen Theologen Arthur Peacocke (damals schon verstorben) und Philip Clayton, die eine Theologie namens „Panentheismus-Emergentismus-Naturalismus“ vertraten, welche meinen Ideen in fast Allem sehr nahe kam, außer dass sie christlich war. Es kam zu einem bis heute sehr freundlichen Austausch mit Clayton, und seither verfolge ich auch mit viel Sympathie die progressiv-protestantischen Bemühungen von ihm und seinen Gesinnungsfreunden in Kalifornien, die sich dem modernen Weltbild und der postmodern-alternativen spirituellen Kultur öffnen wollen. Diese Strömung hat verschiedene Hochschulen und Zentren, etwa in Los Angeles eines namens HatcheryLA.
Dort fand nun kürzlich die Tagung „Enfolding Spirituality“ statt, unter anderem auch mit Spiral-Dynamics-Mitbegründer Don Beck und … Steve McIntosh. Von ihm wusste ich zwar, dass sein Buch „Evolutionäres Bewusstsein“ ins Deutsche übersetzt war, hatte ihn aber bis dahin für eine Figur aus der „zweiten Reihe“ integraler Denker gehalten, und deshalb nicht genauer unter die Lupe genommen. Jetzt erfuhr ich, dass McIntosh gerade das Buch „The Presence of the Infinite“ veröffentlicht hat, und beschloss, evolve eine Rezension des Buches anzubieten. Der sehr freundliche McIntosh schickte mir auf meine Mail-Anfrage hin auch gleich kostenlos das neue Buch und das vorherige, „Evolution’s Purpose“, gleich mit dazu. Wie Steve McIntosh selbst sagt, ist er von Philip Clayton stark beeinflusst. So schließt sich für mich ein Kreis, und allmählich fange ich an, die philosophisch-spirituelle Avantgarde-Szene in den USA besser zu verstehen – die unsere deutsche integrale Szene ja sehr stark prägt.

Steve McIntosh beschreibt diese Szene und ihre Wurzeln übrigens in seinem ersten Buch „Integrales Bewusstsein“ sehr schön sachlich. Ein Ableger von Ken Wilber ist McIntosh also auf gar keinen Fall. Ich würde sogar sagen, dass er das integral-evolutionäre Establishment, mit dem er von den Ideen her, aber auch menschlich eng verbunden ist, in einem wichtigen Punkt ganz massiv herausfordert … und die meisten, die dies hier lesen, wahrscheinlich auch. McIntosh behauptet nämlich – halten Sie sich fest! –, dass die Non-Dualität in Reinkultur nicht für ein integrales Gottesbild ausreicht, sondern darin nur ein Pol sein kann, zusammen mit einem „Gegen-Pol“, der mehr dem liebevollen Schöpfergott des Theismus ähnelt. Erst wenn die Abhängigkeit und Spannung dieser beiden Pole Gottes zugelassen und „gehalten“ wird, hat man in McIntoshs Augen ein Gottesbild, das einer voll entwickelten evolutionär-integralen Spiritualität gerecht wird.
Mir gefällt diese Herausforderung an Lehren, die Gott ohne Weiteres mit „dem Zeugen“, einem leeren Ur-Bewusstsein identifizieren wollen, das viele in der Meditation ganz zu erfahren meinen und von dem sie glauben, dass auf ihm alles in der Welt, auch wir Menschen, entstehen und vergehen wie Wolkenfetzen vor dem Himmel. Jahrtausende alte spirituelle und philosophische Traditionen des Westens werden von den Anhängern dieser reinen Non-Dualität einfach abgetan. Zu Unrecht, so McIntosh, denn die non-duale Spiritualität schließt einiges aus, was für eine integrale Spiritualität maßgeblich wäre. Das Grundproblem dabei ist die Sache mit Samsara bzw. Maya, die Lehre, dass die Welt der Individuen und Formen, im Grunde alles außer Gott, leidvolle Illusion ist, die überwunden werden muss. Was dabei „hinten runterfällt“ ist erstens das göttliche Schaffen und Antreiben der natürlichen Ordnung und Evolution, die ja offensichtlich menschliche Werte, Vernunft und Spiritualität hervorbringt. In der Welt ist nicht nur nichtiger Schein am Werk, sondern auch umfassender Sinn, und dabei entsteht Wertvolles, nicht zuletzt wir selber. Zu uns gehört auch, dass wir charakterlich, zwischenmenschlich und spirituell noch mehr werden wollen, sicher nicht nur ein Sich-Aufgeben, sondern auch ein Sich-Weiterentwickeln. Dabei bekommen wir manchmal etwas, was sich für viele wie Zuneigung, Inspiration und Zuwendung „von oben“ anfühlt, wie ein für sie ganz persönlich passendes Geschenk. So eine Beziehung des Einzelnen zum Göttlichen ist auch etwas, was aus der formlosen, bewusstlosen, willenlosen Leere, dem „Gott“ der Non-Dualität, überhaupt nicht zu verstehen ist. Das traditionelle theistische Gottesbild z. B. des Christentums dagegen hat bei all seiner Überpersonifizierung Gottes gerade davon schon mehr verstanden. Hier gibt es also allerhand zu integrieren.
McIntosh setzt nun dieser Kritik noch eins drauf, er begründet nämlich die Einseitigkeit des „Non-Dualismus“ auch mit einem Argument der soziokulturellen Evolution, das erklärt, warum sich heute so viele sonst so verschiedene spirituelle Gruppen und Individualisten auf die Non-Dualität einigen können. Weil diese Art von Spiritualität eben nicht für eine integrale Spiritualität typisch ist, in die wir uns erst hineinentwickeln, sondern für die spät-postmoderne Spiritualität, in der wir uns größtenteils noch befinden.
Was soll das sein, eine Abwertung, eine Provokation? Nein, gar nicht, für Steve McIntosh ist einfach klar, dass eine evolutionäre Philosophie auch sozio-kulturell jede große geistige und spirituelle Strömung einigermaßen verorten können muss. Und der Ort der Non-Dualität kann für ihn nur der postmoderne Anteil moderner Gesellschaften sein, wir in Deutschland würden vielleicht sagen: die alternativen Subkulturen. Seit den 60er Jahren sind sie gegen die bekannten inhumanen Folgen sowohl der traditionellen als auch der modernistischen Anteile unserer bürgerlichen Nachkriegs-Gesellschaften aufgestanden: Leistungswahn, Konsumismus, Natur-Zerstörung, mangelnde Hilfe für die (ökonomisch) schwächeren Individuen, Gruppen und Völker, Zerfall der Familie, Sinnverlust, die Herrschaft der Wirtschaft, Selbstverwirklichung nur in Rahmen vom Besitz und sozialem Funktionieren und und und. Was das postmoderne Milieu sonst verbindet, ist ein toleranter Relativismus und ein sympathisches und solidarisches Begleiten der Selbstverwirklichung eines jeden.
Das ist natürlich alles gut – aber für McIntosh zu wenig. Von einer integral geprägten Avantgarde könnte man nämlich erst dann sprechen, wenn sie die Kraft hätte, die traditionellen und modernistischen Milieus und Schichten einer Nation tatsächlich geistig, moralisch und politisch mitzunehmen und eine demokratische, gestaltungsfähige Perspektive zu vermitteln. Diese „Fähigkeit zu führen“, wie McIntosh das nennt, hat der postmoderne Teil unserer spätindustriellen Gesellschaften recht offensichtlich nicht, und am allerwenigsten in seiner eigenen Heimat. In den USA wird ja – besonders vom traditionell orientierten Teil der Nation – ein „culture war“ gegen den modernistisch und den postmodern orientierten Teil ausgefochten, mit großer Brutalität, nahezu völliger Unversöhnlichkeit und bedenkenlosen Einsatz fast aller Mittel. Bei uns in Mittel- und Nord-Europa dagegen sind postmoderne Werte schon bis weit in die traditionelleren „populären“ Schichten durchgesickert. Wir haben postmoderne Parteien, und auch die anderen reden oft ziemlich postmodern daher. Etwas Anderes ist bei uns verpönt und marginalisiert. Wir sind also einer Koexistenz der traditionellen, modernistischen und postmodernen Milieus also (jedenfalls im Moment) recht nah. Einen Sprung ins Integrale kann hingegen ich nicht feststellen.
Steve McIntosh sieht daher innerhalb unserer westlichen Gesellschaften eine Art interkulturelle Werte-Arbeit zu leisten: die jeweilige „Geistigkeit“ („spirituality“) der drei wichtigsten Milieus zu integrieren. Und damit wären wir jetzt wieder bei der Weiterentwicklung des Gottesbildes über die pure Non-Dualität hinaus. Nötig wäre eine Art dialektischer Synthese zwischen dem traditionellen Theismus, dem modernistischen Naturalismus und der post-modernen Non-Dualität. McIntosh nennt solch ein Gottesbild (wie auch Clayton, ich und andere es tun) Panentheismus. Dieses Gottesbild muss den transzendenten Gott, der außerhalb der Welt ist, und den immanenten Gott, der alles in der Welt ist, in sich „aufheben“. Aber wie soll das gehen? Die panentheistische Grundidee ist, Gott nicht mit allem und jedem zu identifizieren, ihn aber auch nicht außerhalb der Welt zu sehen, sondern umgekehrt die Welt innerhalb von Gott. So ein Gott ist fast unendlich viel mehr als alles Endliche, z. B. als jeder einzelne Mensch. Zugleich umfasst und durchdringt er aber alles und jeden, etwa auch den Geist des Meditierenden. Gott und der Mensch wären dann zwar verschieden, aber nicht getrennt. Ich bin ganz in Gott, aber ich bin nicht der ganze Gott. Eine Nuance, allerdings möglicherweise die entscheidende, um über die Non-Dualität hinauszukommen.
Steve McIntosh unternimmt am Ende seines Buchs noch einen Versuch, die Spannung zwischen dem personalen und dem non-dualen Pol Gottes zu überbrücken, indem er aus der Zweiheit eine Dreiheit macht. Ich persönlich würde allerdings noch weiter von christlich-theologischen Begriffen weggehen und den Panentheismus radikaler machen: Warum nicht die Spannung, die gegenseitige Abhängigkeit, das Zusammenspiel zwischen dem unendlichen göttlichen Ganzen und den endlichen Dingen, Wesen und Personen, die in ihm leben, als etwas Grundlegendes stehen lassen, als einen Wesenszug der Welt?
Oliver Griebel studierte Philosophie, arbeitet als Sprachenlehrer und ist Autor von “Der Ganzheitliche Gott”.
Professor Philip Clayton von der Claremont University in Kalifornien steht für vieles: für die Alles-ist-in-Gott-Lehre “Panentheismus” – für die Idee einer teils stufenweisen kosmischen Evolution, einer “Emergenz” von Materie über Leben hin zu Person, Kultur und Geist – für die Vision einer sozial-ökologischen Weltzivilisation. Pfarrer Siegfried Finkbeiner und ich, der Philosoph Oliver Griebel (“Der ganzheitliche Gott”), haben Philip eingeladen, mit uns zu diskutieren.
